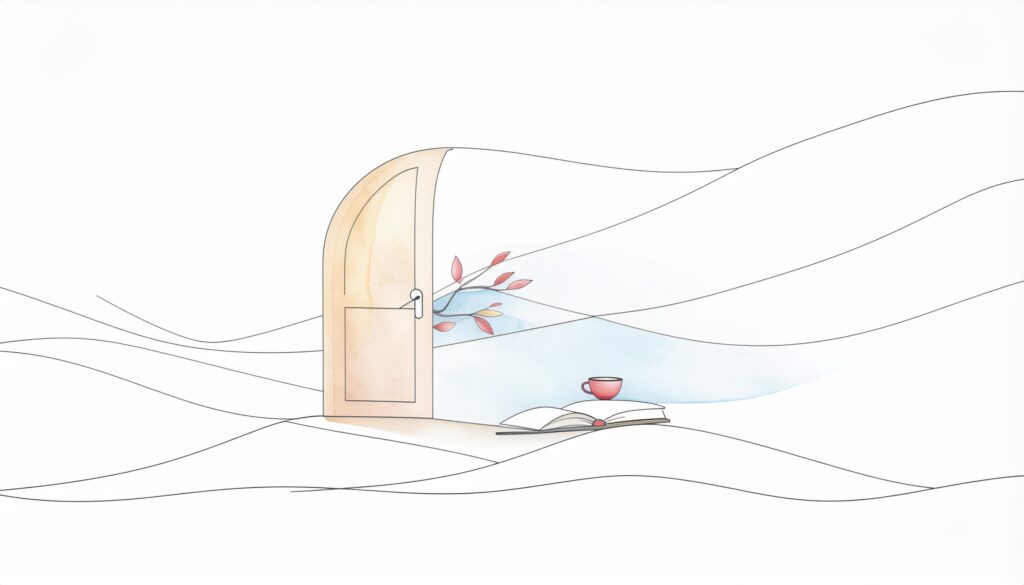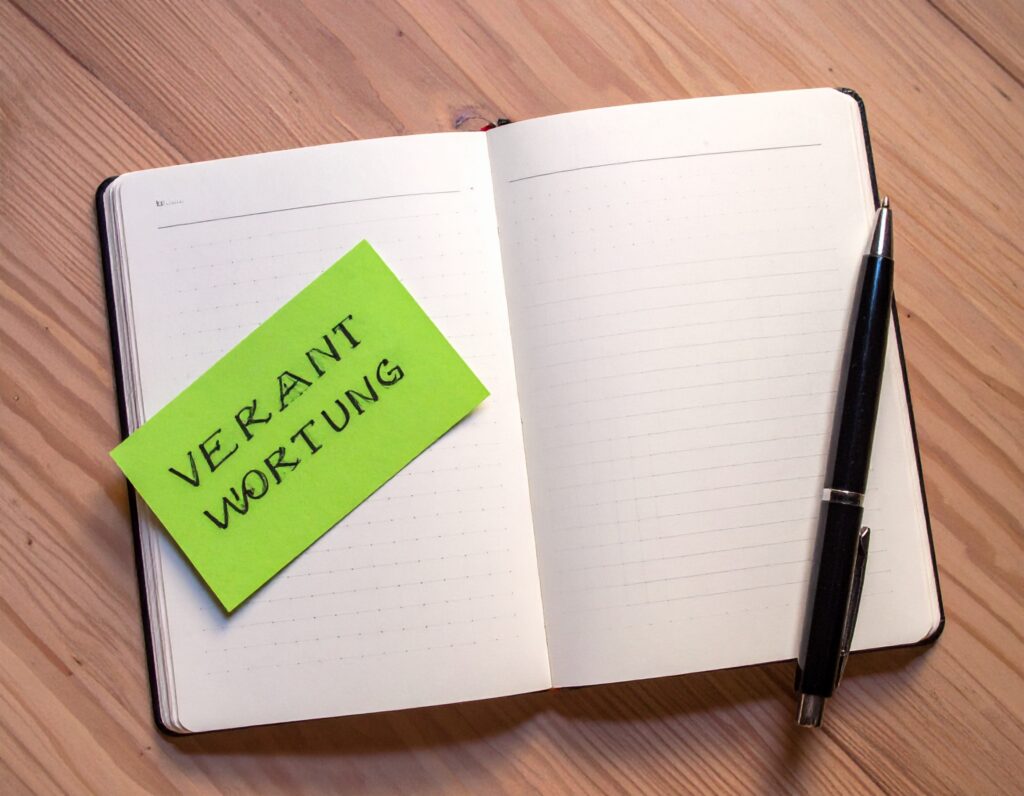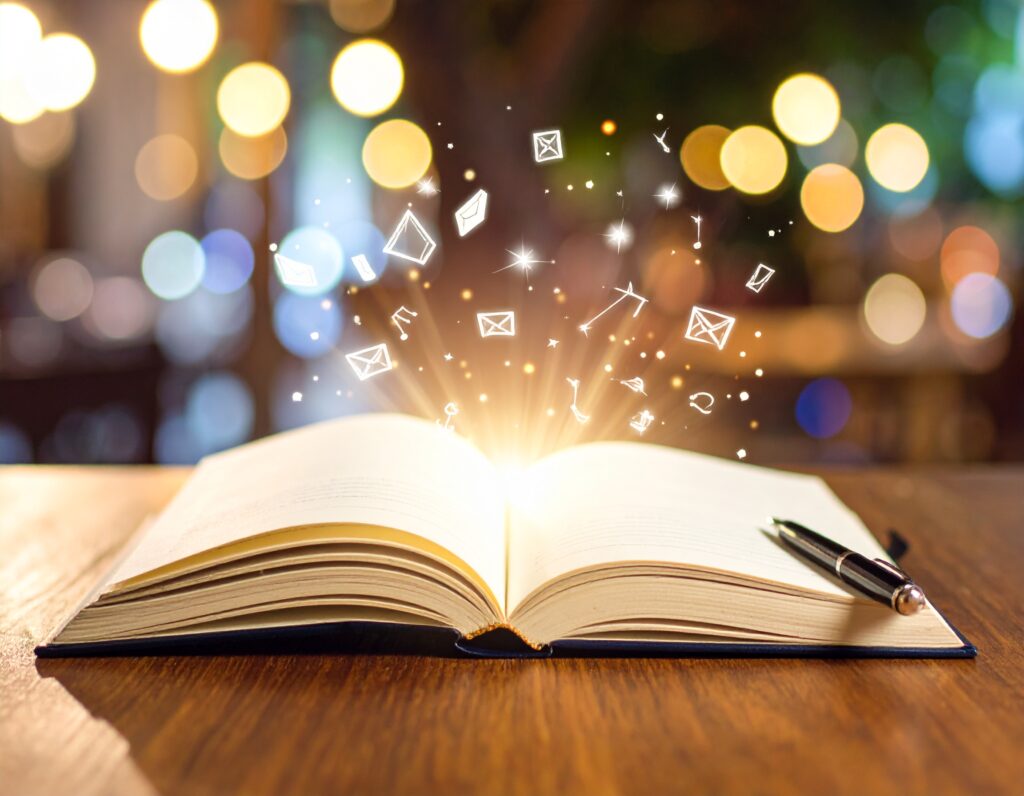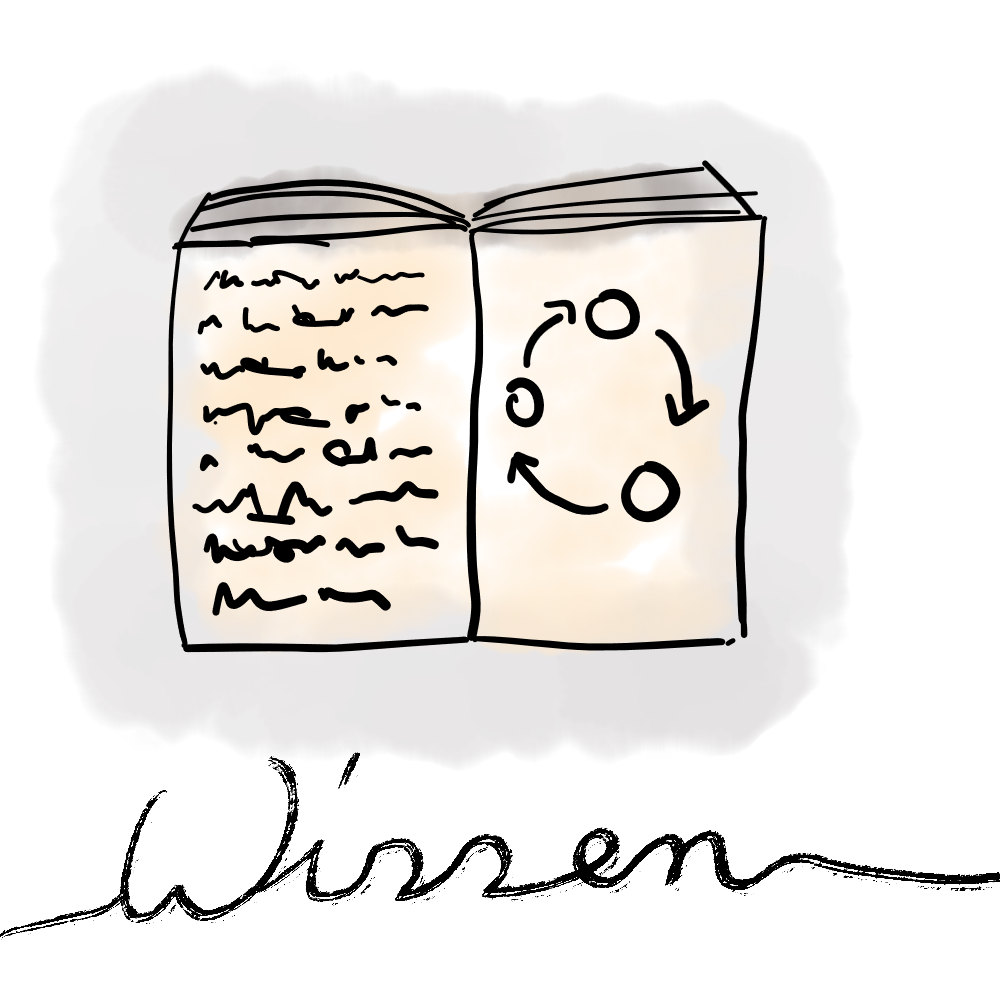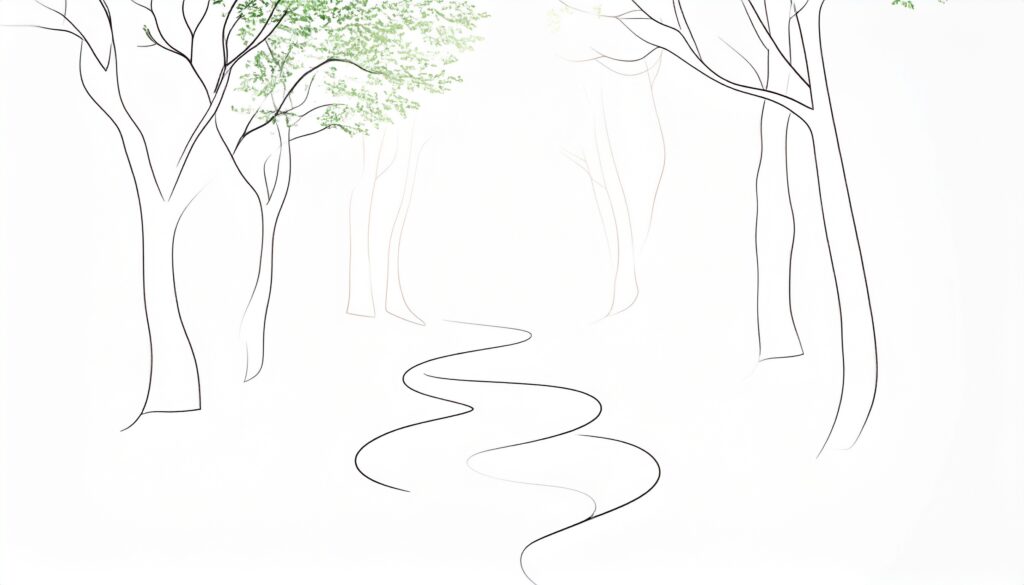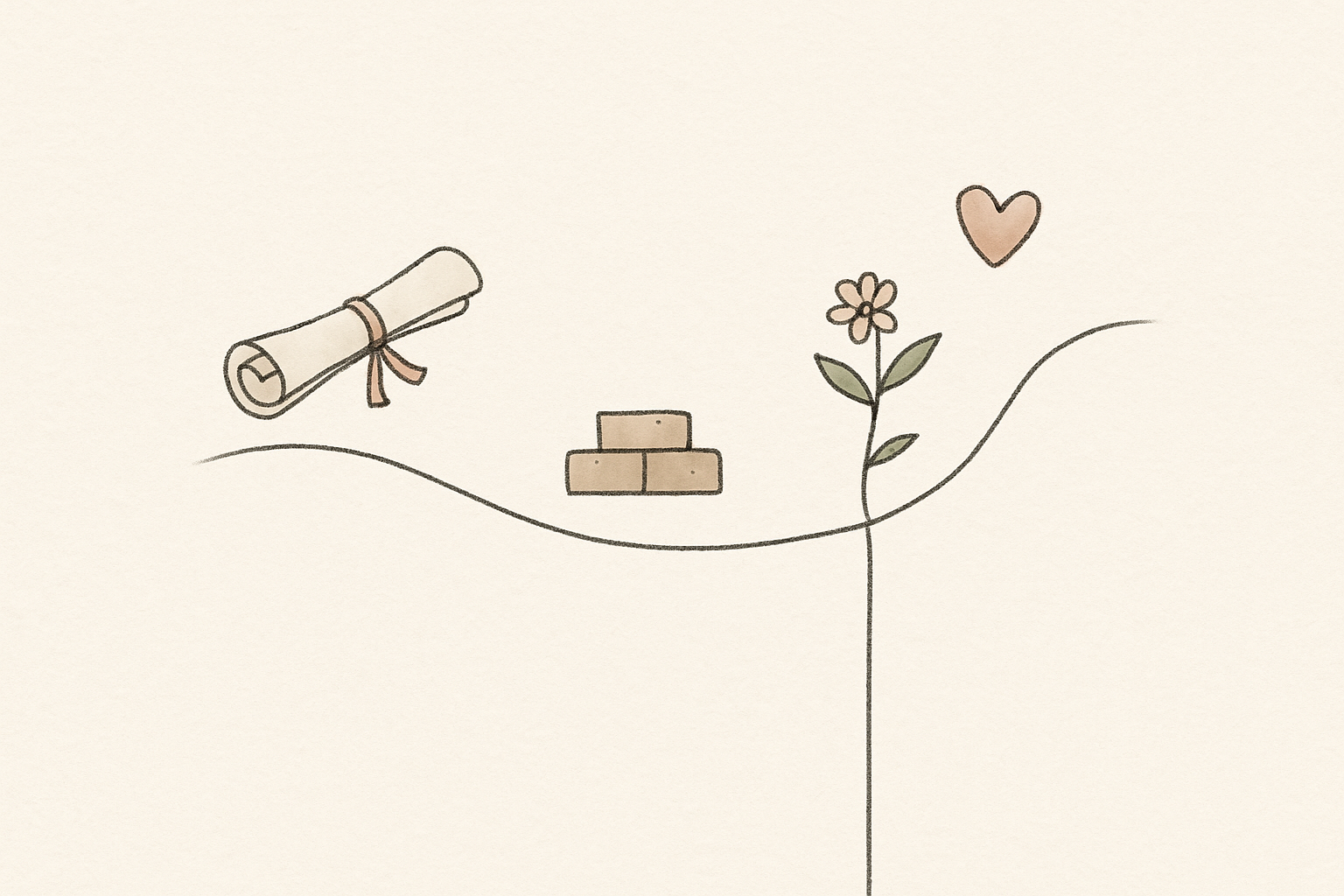Beiträge von Anja Langner
Zwischen Feintuning und Türöffnern – das Jahr 2025
Manchmal öffnet sich eine Tür, die man schon lange beobachtet hat Es gibt diese Momente, in denen sich etwas verändert – nicht mit Lärm, sondern mit einer stillen Selbstverständlichkeit. Da sitzt ein junger Klient vor mir, der noch vor Jahren frustriert aus der Grundschule kam. „Ich kann das nicht“ oder „Ich bin zu dumm“ waren…
WeiterlesenAdventszeit reflektieren: Journaling für mehr Leichtigkeit im Dezember
Der Dezember ist für viele ein hektischer und zugleich ein besinnlicher Monat. Jeder Tag kann beides sein – oder nur eines von beiden – oder etwas ganz anderes. Doch oft gehen die stillen Momente im Trubel unter: die Kerze, die langsam abbrennt, das Lachen beim Plätzchenbacken, die Minute, in der wir einfach nur durchatmen. Deshalb…
WeiterlesenSupervision in der Lerntherapie: Warum kollegialer Austausch deine Arbeit bereichert
Einleitung: Der Moment, in dem alles klarer wird Es gibt diese Situationen in der lerntherapeutischen Arbeit, in denen man sich nichts sehnlicher wünscht, als kurz mit einer Kollegin oder einem Kollegen zu sprechen. Einfach mal durchatmen, die eigenen Gedanken sortieren – und plötzlich sieht man wieder, was wirklich wichtig ist. Doch oft ist dieser Austausch…
WeiterlesenSpielend wachsen – Wie Spiele in Lerntherapie, Coaching und Supervision Ressourcen wecken
Während einer Fortbildung wurden uns verschiedene Spiele angeboten. In kleinen Gruppen durften wir sie ausprobieren. Eines davon war ein einfaches, taktisches Balancierspiel, das viel Absprache und Teamwork erforderte. Es machte uns – zumindest fast allen – viel Freude. Und doch zeigte sich auch: Es gibt Menschen, für die Spiele, die Frustrationstoleranz erfordern, eine Herausforderung darstellen.…
WeiterlesenEin Lesetipp aus der Praxis – Lesetipp im Oktober: Lösungen (er)finden
Diese Literatur begleitet mich… Ein Lesetipp aus der Praxis Lösungen (er)finden von Insoo Kim Berg & Peter de Jong Seit vielen Jahren begleitet mich das Buch Lösungen (er)finden von Insoo Kim Berg und Peter De Jong – nicht bloß als Fachbuch, sondern als eine Haltung in meiner Arbeit mit Lerntherapeutinnen, pädagogischen Fachkräften und Klient:innen. Gerade in der direkten Begleitung zeigt sich immer wieder, wie kraftvoll es ist, nicht das…
WeiterlesenWerte, die tragen – ein methodischer Wegweiser für Fachkräfte in Beratung, Lerntherapie, Coaching und S(s)ozialer Arbeit
Warum Wertearbeit weit mehr ist als ein individuelles Anliegen Werte begleiten uns – immer. In unserem beruflichen Alltag, in Gesprächen mit Klient*innen, in Teams und in Momenten, in denen wir uns entscheiden müssen. Unsere Werte wirken oft im Verborgenen: Sie beeinflussen unsere Haltung, unser Verhalten, unser Denken. Umso wichtiger ist es, sie sichtbar zu machen.…
WeiterlesenWas Fortschritt in der Supervision wirklich bedeutet – Vom Mut, Umwege zu würdigen
Es war eine dieser typischen Situationen: Man nimmt sich etwas vor, es klingt in der Theorie ganz einfach, und dann beginnt man damit – und merkt, dass es doch alles andere als leicht ist. So erging es mir, als ich begann, mich intensiver mit Make zu beschäftigen. Der Gedanke war klar: Prozesse strukturieren, Abläufe automatisieren,…
WeiterlesenDie Kunst der kleinen Schritte – Veränderung beginnt im Konkreten
Veränderung ist ein großes Wort. Es klingt nach Aufbruch, Bewegung, nach Umbruch und neuer Ordnung. In der Realität jedoch zeigt sich Wandel oft viel leiser und kleiner. Er beginnt nicht mit dem großen Wurf, sondern mit einem unscheinbaren Moment der Entscheidung – manchmal kaum sichtbar von außen. Gerade in systemischen Kontexten, sei es in Supervision,…
WeiterlesenDie Methode Timeline – mein Berufsweg
Was bleibt in Erinnerung, wenn man auf den eigenen Werdegang zurückblickt? Welche Wendepunkte, inneren Stimmen und Begegnungen haben dich beeinflusst – welche waren verunsichernd oder mit gemischten Gefühlen geprägt? Die Timeline-Methode, ursprünglich von Peter Nemetschek* entwickelt und später durch dialogische Perspektiven weitergeführt. Die Timeline bietet einen Raum, in dem biografische Stationen nicht nur benannt, sondern…
WeiterlesenAlles über Prozesse in Coaching und Supervision: Grundlagen, Strategien und Praxisbeispiele
Wie verlaufen professionelle Prozesse im Coaching und in der Supervision? Dieser Überblick richtet sich an pädagogische Fachkräfte, Supervisor*innen und Coaches, die ihre Beratungspraxis reflektieren und erweitern möchten. Du findest hier fundiertes Wissen zu Phasen, Wirkfaktoren und Methoden sowie praxiserprobte Beispiele aus unterschiedlichen Settings. Die Grundlagen rund um Prozesse in Coaching und Supervision Was ist ein…
Weiterlesen